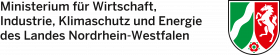„Manche technische Finessen, die in der Forschung spannend sind, lässt man bewusst weg, weil sie in der Praxis keinen Mehrwert bringen.“
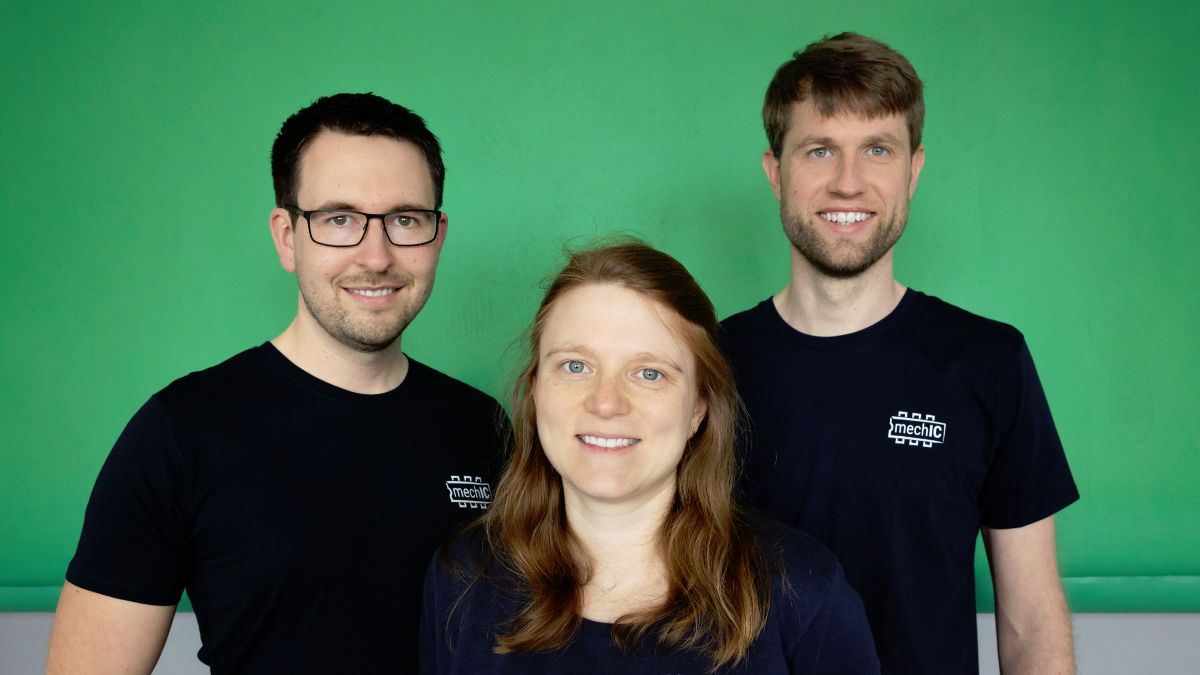
© WORLDFACTORY Start-up Center an der Ruhr-Universität Bochum
Ein Dehnungssensor, der ohne Strom auskommt. Damit setzt das Forschungsteam mechIC an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) neue Maßstäbe in der Sensortechnologie. Nun geht es darum, das innovative Produkt in die Praxis zu überführen. Dr.-Ing. Philip Schmitt, Dr.-Ing. Lisa Schmitt und Steffen Wittemeier sind gerade mit den notwendigen Vorbereitungen dafür beschäftigt. Unterstützt werden sie dabei von der WORLDFACTORY, dem Start-up Center der RUB. Erste Erfolge konnte das Gründungsteam bereits feiern: Im März 2025 wurde das Team vom Bundeswirtschaftsministerium mit dem Gründungspreis+ ausgezeichnet. Im folgenden Gespräch erklärt Dr.-Ing. Philip Schmitt, wie die Idee entstanden ist und wie ihr Weg von der Forschung hinaus in die Start-up-Welt aussieht.
Herr Dr. Schmitt, bevor wir über Ihr Produkt und Ihre Gründungsvorbereitungen sprechen – können Sie uns kurz erklären, was genau ein Dehnungssensor ist?
Dr.-Ing. Schmitt: Gerne. Dehnungen entstehen überall dort, wo sich Materialien wie Metall, Beton oder Holz durch Belastung verformen – zum Beispiel in Brücken, in Maschinen oder auch in Küchenwaagen. Dehnungssensoren – in der Regel handelt es sich dabei um sogenannte Dehnungsmessstreifen – messen diese Verformungen. Das Problem ist, dass deren Einsatz Strom benötigt. Außerdem werden sehr viele Daten produziert, die aufwendig ausgewertet werden müssen. Das wird vor allem bei großen Bauwerken mit vielen Sensoren schnell sehr komplex.
Sie haben nun gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen eine Alternative entwickelt, die bereits für Schlagzeilen gesorgt hat. Das Bundeswirtschaftsministerium schreibt in einer Pressemitteilung, Sie revolutionieren die Dehnungssensorik. Was macht Ihr Sensor anders als bisherige Systeme?
Dr.-Ing. Schmitt: Zunächst einmal funktioniert unser Sensor vollständig mechanisch und nicht elektrisch. Er nutzt die mechanische Energie, die durch die Verformung des Materials entsteht und verarbeitet die Messung mit Hilfe eines mechanischen integrierten Schaltkreises. Dadurch entfallen Kabel, Batterien oder Solarzellen – das spart Aufwand und Kosten beim Einbau und im Betrieb. Hinzu kommt: Der Sensor speichert wichtige Daten direkt mechanisch in seinem Inneren und benötigt dafür auch keine elektrische Energie. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Daten zur Häufigkeit bestimmter Überlastungen. Diese Informationen lassen sich dann bei regelmäßigen Wartungen auslesen – man braucht also keine permanente Datenübertragung.
Wie groß ist dieser Sensor?
Dr.-Ing. Schmitt: Der Sensor ist winzig – etwa so groß wie ein Chip. Er lässt sich direkt auf Schrauben, Wellen oder in Betonbauteile integrieren, also überall dort, wo mechanische Belastungen überwacht werden sollen.
Die Idee dafür entstand an der TU Ilmenau?
Dr.-Ing. Schmitt: Richtig, die Grundidee für energieautarke Sensoren entstand schon vor meiner Zeit in einem Forschungsprojekt meines Doktorvaters, Prof. Martin Hoffmann. Damals ging es vor allem um Temperatur- und Sauerstoffsensoren. Während meiner Promotion an der TU Ilmenau und später an der Ruhr-Universität Bochum wurde die Idee für energieautarke Sensoren weiterentwickelt, wobei ich mich insbesondere mit der Optimierung von Dehnungssensoren beschäftigt habe.
Der Hintergrund war, dass sich die bisherige Technik seit den 1930er Jahren kaum verändert hat – obwohl sich die Anforderungen weiterentwickelt haben. Daraus entstand die Vision, eine einfache, robuste und vor allem energieautarke Lösung zu finden. Die ersten Patente dafür hatten wir bzw. die TU Ilmenau schon früh angemeldet. Das war für mich ein Signal, dass die Idee genug Potenzial hatte, um die Forschungsergebnisse in die Praxis zu überführen. Klar war aber auch: Der Weg bis zu einem marktfähigen Produkt würde noch lang sein.
Wie kam es zu dem Wechsel von der TU Ilmenau an die Ruhr-Universität Bochum?
Dr.-Ing. Schmitt: Im Jahr 2017 wurde Professor Hoffmann an die Ruhr-Universität Bochum berufen. Damit „wanderten“ auch die Forschungsarbeiten an das dortige Institut für Mikrosystemtechnik. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung konnten wir dann die Forschungsarbeiten im Rahmen der Förderung ForMikro- UpFuse weiter ausbauen. Als Projektbeteiligte kamen u.a. Steffen Wittemeier, Elektroniker und RFID-Fachmann, und später auch Dr.-Ing. Lisa Schmitt, hinzu. Im Verlauf unserer intensiven Zusammenarbeit fiel dann irgendwann die Entscheidung, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Kurz darauf haben wir sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht und EXIST-Forschungstransfer beantragt, um unser Forschungsprojekt mechIC in ein erfolgversprechendes Start-up zu überführen.
Bei Ihren bisherigen Gründungsvorbereitungen stand Ihnen das Startup Center WORLDFACTORY an der RUB zur Seite. Wie kann man sich den Support vorstellen?
Dr.-Ing. Schmitt: Das Team der WORLDFACTORY hat uns in vielen Bereichen unterstützt, sei es durch Workshops zum Thema Teambuilding oder zu Vertriebsstrategien oder auch ganz praktisch bei Pitch-Trainings und der Antragstellung für Förderprogramme wie EXIST. Besonders das Coaching und die Hilfe bei administrativen Hürden waren enorm hilfreich. Allein die Antragstellung von EXIST-Forschungstransfer hat es zum Beispiel wirklich in sich. Dafür braucht es viel Know-how. Genau das besitzt das WORLDFACTORY-Team. Sehr geholfen hat uns auch der Kontakt zu anderen Gründungsteams sowie zu Beraterinnen und Beratern. Der Zugang zu diesen verschiedenen Netzwerken war und ist ein riesiger Pluspunkt.
Darüber hinaus hat uns die Teilnahme an internationalen Workshops und Messen ermöglicht, frühzeitig wichtige internationale Verbindungen aufzubauen.
Nicht zuletzt ist die WORLDFACTORY für uns auch eine Art interne Lobby an der Universität: Sie setzt sich für unsere Interessen ein und öffnet uns Türen zu universitären Einrichtungen, die sonst schwer zugänglich wären.
Gab es einen Moment, an dem Ihnen klar wurde: Unternehmertum ist doch etwas ganz anderes als Forschung?
Dr.-Ing. Schmitt: Ja, ganz eindeutig. Die Gründungsszene ist überraschend familiär und unterstützend. Auch wenn viele ähnliche Ideen verfolgen, herrscht ein großes Gemeinschaftsgefühl – man sitzt im selben Boot und muss ähnliche Herausforderungen bewältigen. In der Wissenschaft dagegen ist der Konkurrenzdruck höher: Jede und jeder will der oder die Erste sein. Als Gründerin oder Gründer muss man pragmatischer denken. Das Produkt muss funktionieren, zuverlässig sein und sich wirtschaftlich herstellen lassen. Manche technische Finessen, die in der Forschung spannend sind, lässt man bewusst weg – einfach weil sie in der Praxis keinen Mehrwert bringen oder zu teuer wären.
Was waren denn die größten Herausforderungen in der Anfangsphase?
Schmitt: Die technischen Herausforderungen sind nach wie vor konstant groß. Unsere Sensoren basieren auf Halbleitertechnologie und deren Produktion ist teuer. Deshalb testen wir viele Varianten an der Universität, bevor wir eine größere Stückzahl herstellen lassen. Die EXIST-Förderung, die wir seit April 2024 bekommen, hilft uns dabei sehr – sie erlaubt es uns, erste Prototypen zu entwickeln und zu erproben.
Ihre Sensoren sind vielseitig einsetzbar – in welchen Bereichen sehen Sie aktuell die größte Nachfrage?
Dr.-Ing. Schmitt: Die Bandbreite ist tatsächlich groß – vom klassischen Bauwesen über Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Infrastrukturüberwachung. Wir sind deshalb viel auf Fachmessen unterwegs, zuletzt auf der Hannover Messe, um mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen und deren Bedarfe besser zu verstehen. Momentan befinden wir uns noch in der Testphase und führen erste Proof-of-Concept-Projekte durch. Das heißt: Wir schauen gemeinsam mit den Unternehmen, ob unser Sensor deren spezifischen Anforderungen erfüllt.
Im März 2025 wurden Sie durch das Bundeswirtschaftsministerium mit dem Gründungspreis+ ausgezeichnet. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie und Ihr Team?
Dr.-Ing. Schmitt: Das war eine große Anerkennung für unsere Arbeit. Die Auszeichnung hat uns gezeigt, dass unser Ansatz nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Gründungsszene wahrgenommen wird. Das motiviert natürlich und hilft uns auch in Gesprächen mit potenziellen Partnern, Investoren oder Kunden – die Sichtbarkeit ist extrem wichtig für junge Unternehmen. Außerdem hilft uns das Preisgeld, die Übernahme der von der TU Ilmenau angemeldeten Patente zu finanzieren sowie einen Prototyp aufzubauen.
Wie wichtig ist der Patentschutz für Ihr Start-up?
Dr.-Ing. Schmitt: Der Besitz von IP-Rechten ist eine ganz zentrale Voraussetzung für den unternehmerischen Erfolg. Ohne diesen Schutz kann eine technische Innovation sehr schnell kopiert werden. Patente geben einem daher als junges Unternehmen die nötige Sicherheit – sowohl strategisch als auch wirtschaftlich.
Deswegen ist die Übernahme der Patentrechte auch so wichtig für uns. Wie diese Übernahme im Endeffekt aussehen wird, kann ich noch nicht sagen. Wir stehen noch in Verhandlungen mit der TU Ilmenau und der Ruhr-Universität. Insgesamt erlebe ich diese Verhandlungen aber als sehr gründerfreundlich, so dass ich zuversichtlich bin, dass wir eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden werden.
Neben den IP-Verhandlungen mit den beiden Hochschulen stehen vermutlich noch eine ganze Reihe weiterer Aufgaben an. Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?
Dr.-Ing. Schmitt: Wir wollen jetzt die ersten Pilotprojekte mit Kunden erfolgreich abschließen und das Produkt technisch weiterentwickeln. Außerdem evaluieren wir neue Anwendungsfelder, etwa im Bereich erneuerbare Energien oder kritische Infrastrukturen. Die Unterstützung durch die RUB und die WORLDFACTORY bleibt dabei weiterhin ein entscheidender Faktor für uns.
Weitere Informationen:
Stand: April 2025

Die Initiative Exzellenz Start-up Center.NRW fördert das Projekt WORLDFACTORY Start-up Center (WSC) an der Ruhr-Universität Bochum (RUB).
- Start-up Talk
- Interview mit Dr. Andreas Mischok, Gründungsteam PoLightFilters
- Interview mit Lucas Jonas, Co-Founder der Einklang NE Solutions GmbH
- Interview mit Lennard Bennemann und Hendrik Wever, Gründungsteam PottPilz
- Interview mit Dr.-Ing. Surkamp und Jasper Helle, Gründungsteam PicoShape
- Interview mit Daniel Porzig, Co-Founder der heygrün GmbH
- Interview mit Dr.-Ing. Philip Schmitt, Gründungsteam mechIC
- Interview mit Dr. Maximilian Hartmann, Co-Founder der vGreens Holding GmbH
- Interview mit Antonia Langner, Co-Founderin der LastBIM GmbH
- Interview mit Leo Wiegand, Co-Founder der ONE WARE GmbH
- Interview mit Dr. Richard Ramakers, Co-Founder der O11 biomedical GmbH
- Interview mit Dr. Adam Widera und Dr. Michael Middelhoff, Gründungsteam CrisisCube
- Interview mit David Goldschmidt und Finn Rübo, Co-Founder der Datapods GmbH
- Interview mit Maximilian Spiekermann und Max Krause, Gründungsteam Simplyfined
- Interview mit Dana Aleff, Co-Founderin der Circonomit GmbH
- Interview mit Pia Hildebrandt, Co-Founderin der concepte Solutions GbR
- Interview mit Moritz Schmidt, Co-Founder der utilacy GmbH
- Interview mit Tobias Barg und Dr. Felix Sümpelmann, Co-Founder der aalto Health GmbH
- Interview mit Dr. Katharina C. Cramer, Gründungsteam Tiller Alpha
- Interview mit Felix Kathöfer, Co-Founder der KATMA CleanControl GmbH
- Interview mit Ronja Weidemann, Fabienne Ryll und Abirtha Suthakar, Gründungsteam PhosFad
- Interview mit Benjamin Kasten, Co-Founder der ladeplan UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Prof. Dr. Rafael Kramann, Prof. Dr. Rebekka Schneider, Co-Founder der Sequantrix GmbH
- Interview mit Yasin Demir, Co-Founder der GreenDeal GbR
- Interview mit Katharina von Stauffenberg, Co-Founderin von comuneo
- Interview mit Sven Maihöfer, Co-Founder der xemX materials space exploration GmbH
- Interview mit Dr. Johannes Wappenschmidt, Co-Founder der Vintus GmbH
- Interview mit Tobias Burger, Co-Founder der red cable robots GmbH
- Interview mit Philipp Pflüger, Co-Founder der ChemInnovation GmbH
- Interview mit Deniz Ates, Co-Founder der Who Moves UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Jakob Vanhoefer, Gründer der LightningPose GmbH
- Interview mit Dr. Reza Esmaillie, Co-Founder der Detechgene GmbH
- Interview mit Lukas Klaßen, Co-Founder von „Knowledge in a Box“
- Interview mit Dr. Philipp Wrycza, Co-Founder der Logistikbude GmbH
- Interview mit Christoph Milder, DEVITY-Team
- Interview mit Jonas Spieth, Co-Gründer der lodomo GmbH
- Interview mit dem Gründungsteam der Laminar Solutions UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Alexander Pöhler und Xiaojun Yang, Gründungsteam der assemblean GmbH
- Interview mit Marc Leonard Leineweber, Gründungsteam HoLa
- Interview mit Dr. Niklas Hellemann, Co-Founder der SoSafe
- Interview mit Hendrik Bissing, Gründungsteam SLVISIONS
- Interview mit Elena Kirchner, Co-Gründerin der umaversum reproductive health GmbH
- Interview mit Gerrit Agel, Co-Gründer der CYBRID GbR
- Interview mit Lena Benecken, Co-Gründerin der EASI Control GmbH
- Interview mit Sinem Atilgan, Co-Grünerin der 4traffic SET GmbH
- Interview mit Doris Korthaus, Co-Gründerin der Korthaus Pumpen GmbH
- Interview mit Dr.-Ing. Friederike Kogelheide, Gründungsteam Glim Skin
- Interview mit Moritz Schmidt, Teammitglied von Gemesys
- Interview mit Dr. Alexander Schneider und Michael Birkhoff, Co-Gründer der schnaq GmbH
- Interview mit dem Gründungsteam von Acuire
- Interview mit Dr.-Ing. Peter Schlanstein und Niklas Steuer, Co-Gründer der HBOX Therapies GmbH
- Interview mit Sven Wauschkuhn, Co-Gründer der Excellence Coatings GmbH
- Interview mit Anne Janser, Co-Gründerin von WorXplorer
- Interview mit Paul Sabarny und Lilian Schwich, Gründungsteam der cylib GmbH
- Interview mit Stefan Paulus, Co-Gründer der azernis GmbH
- Interview mit Steffen Gerlach, Co-Gründer der EEDEN UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Sandra Stoppert, Gründerin von „Grünes Konfetti“ und „Tanzraum Remscheid“
- Interview mit Dr. David Dung, Gründungsteam Midel Photonics
- Interview mit Dr. Michael Schmidt, Co-Gründer von ESKITEC
- Interview mit Magnus Schückes, Co-Gründer der Elona Health GmbH
- Interview mit Alexander Haufschild, Co-Gründer der socialbnb GmbH
- Interview mit Jan Bernholz, Co-Gründer der eseidon GmbH“
- Interview mit Dr. Robert Brüll, Co-Gründer der FibreCoat GmbH
- Interview mit Dr. Matthias Kiel, Geschäftsführer der qubeto GmbH
- Interview mit Marius Ruhrmannm, Geschäftsführer der MapAd GmbH
- Interview mit Sigrid Dispert, Gründungsteam Memogic
- Interview mit Nathalie Prokop, Co-Gründerin von noho
- Interview mit Michael Rieger, Co-Gründer der FreeD Printing GmbH
- Interview mit Dr. Timo Bathe und Alexander Ott, die Gründer der [Tool]Prep UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Sarah Theresa Schulte, Co-Gründerin der AllCup GbR
- Interview mit Christoph Seidenstücker, Co-Gründer der Pixel Photonics UG
- Jochen Schwill, Next Kraftwerke GmbH
- Thomas Roth, Co-Gründer des Medizintechnik-Start-ups InnoSurge AC
- Start-up Profiles