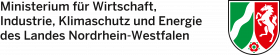„Insgesamt ist die Unterstützung äußerst hilfreich – fachlich wie strategisch.“
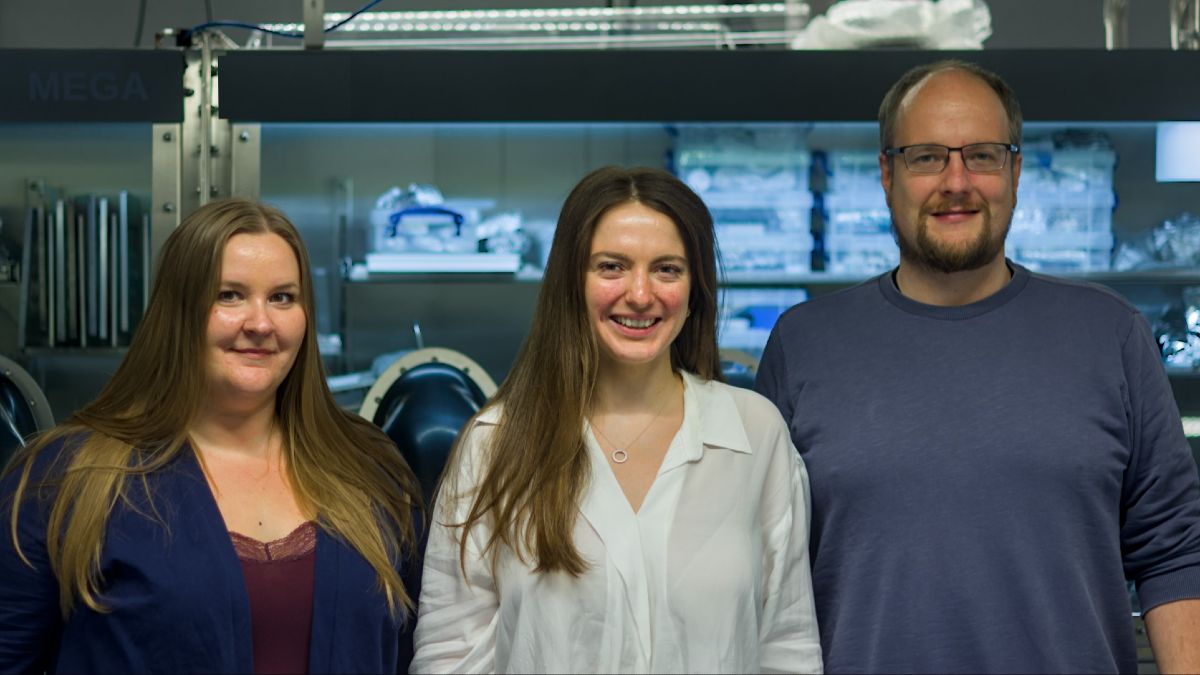
© Andreas Mischok
Mit einem neuartigen Lichtfiltersystem möchte das Team von PoLightFilters die Farbfilterung in der biologischen Forschung revolutionieren. Der Physiker Dr. Andreas Mischok hat die neue Technologie in einem langjährigen Forschungsprojekt an der Universität zu Köln entwickelt. Aktuell bereitet er sich mit der Physikerin Anja Lindenau und Elena von der Heyden, die einen Master in International Management besitzt, sowie Prof. Dr. Malte Gather, Direktor des Humboldt Zentrums für Nano- und Biophotonik, auf die Gründung des gemeinsamen Start-ups vor. Tatkräftig unterstützt wird das Team dabei vom Gateway Exzellenz Start-up Center der Universität zu Köln und deren Transferabteilung. Im Interview berichtet Andreas Mischok über die wissenschaftlichen Ursprünge der Idee, den Weg aus dem Labor in die Wirtschaft und darüber, warum ein perfektes Produkt allein noch lange kein Unternehmen macht.
Herr Dr. Mischok, Sie entwickeln eine spezielle Technologie zur Filterung von Licht. Was ist das Besondere daran?
Dr. Mischok: Dazu muss man zunächst wissen, dass herkömmliche Farbfilter, also spektrale Filter, aus mehreren hauchdünnen Schichten, wie zum Beispiel aus Metalloxiden, bestehen, die auf einer Glasscheibe aufgetragen sind. Diese filtern die jeweiligen Wellenlängen des Lichts und ermöglichen so die Wahrnehmung einzelner Farben. Diese Dünnschichtfilter sind grundsätzlich sehr zuverlässig. Sie haben jedoch einen Nachteil: Sobald man das Glas auch nur leicht kippt, verändern sich die Filtereigenschaften und damit auch die wahrgenommenen Farben. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel: Die schillernden Farben einer Seifenblase basieren auf Dünnschichtinterferenzeffekten in der dünnen „Haut“ der Blase, auch hier ändert sich die Farbe je nach Betrachtungswinkel und führt zu bunten Regenbogenfarben. Genau dieses Phänomen der winkelabhängigen Farbverschiebung tritt auch bei herkömmlichen Farbfiltern auf, die in vielen optischen Sensoren verbaut sind. Nahezu jedes technische Endgerät enthält solche Sensoren – und in den meisten Fällen arbeiten sie mit spektralen Filtern, also Dünnschichtsystemen.
Und was ist bei Ihrem System anders?
Dr. Mischok: Wir setzen gezielt organische Farbstoffe in Form von Kohlenwasserstoffmolekülen zur Filterung ein. Mit diesen sogennanten Polaritonfiltern gleichen wir die Winkelabhängigkeit aus. Ganz gleich, wie man durch den Filter blickt: man sieht stets dieselben Farben. Dies hilft, störende Lichteinflüsse aus verschiedenen Winkeln zu reduzieren. In der Optik spricht man auch davon, das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern.
In welchem Kontext ist das Ganze entstanden?
Dr. Mischok: Die ersten Berührungspunkte mit der Thematik ergaben sich während meiner Promotion zu organischen Lasern an der TU Dresden. Danach, im Jahr 2017, bin ich dann mit einem Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft als Postdoc an die University of St. Andrews in Schottland gegangen, um in der Arbeitsgruppe von Professor Malte Gather mitzuarbeiten. Dort entstand die grundlegende Idee für das neue Filtersystem – wir standen damals allerdings noch ganz am Anfang.
Das änderte sich 2021 als Professor Gather einen Ruf an die Universität zu Köln annahm. Er übernahm dort die Leitung des Humboldt Zentrums für Nano- und Biophotonik am Department für Chemie und Biochemie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Ich selbst erhielt ein Marie-Curie-Stipendium und bin Professor Gather gewissermaßen nach Köln gefolgt. Dort entstand dann die Idee, die von uns entwickelte Filtertechnologie in der Fluoreszenzmikroskopie einzusetzen. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Lichtmikroskopie, die vor allem in der biologischen Forschung eine Rolle spielt. Mit dieser Methode lassen sich einzelne Moleküle in Zellen oder Geweben sichtbar machen.
Bei der Forschung allein ist es aber nicht geblieben. Sie haben dann auch den Entschluss gefasst, sich selbstständig zu machen. Wie kam es dazu?
Dr. Mischok: Das war eigentlich kein neuer Gedanke. Ich hatte schon an der TU Dresden miterlebt, wie sich einige meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen auf den Weg ins Unternehmerleben vorbereitet haben. Das fand ich ganz spannend, so dass ich immer im Hinterkopf hatte, diesen Weg eventuell auch zu gehen. An der Universität zu Köln war ich ohnehin bereits in Kontakt mit der Transferabteilung und mit dem Gateway-Team. Da ging es zunächst um Fragen zu unserer ersten Patentanmeldung. Als ich dann von unserer neuen Idee für die Fluoreszenzmikroskopie erzählte, riet mir das Gateway-Team, mich für das GO-Bio-initial-Programm des Bundesforschungsministeriums zu bewerben, um unsere Idee weiter zu entwickeln. Das hat tatsächlich auf Anhieb geklappt.
Und nicht nur das. Neben der GO-Bio-Förderung erhalten Sie auch EXIST-Forschungstransfer. Wie kam es dazu?
Dr. Mischok: Ja, EXIST-Forschungstransfer hatten wir parallel beantragt und auch das hat erfreulicherweise sofort geklappt. Das Programm des Bundeswirtschaftsministeriums dient vor allem dazu, unsere Polaritonfilter als optische Beschichtungen und Filter zur Marktreife zu entwickeln. Darüber hinaus ermöglicht uns EXIST-Forschungstransfer den Einstieg in die Start-up-Welt und qualifiziert uns für eine unternehmerische Karriere. Die GO-Bio Förderung bezieht sich dagegen auf die Entwicklung eines Prototyp für ein Lab-on-Chip System in der Fluoreszenzmikroskopie für biomedizinische Untersuchungen.
Sie sprechen von „uns“. Wer gehört alles zum Gründungsteam?
Dr. Mischok: Für EXIST-Forschungstransfer braucht es ein Team, das möglichst alle fachlichen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen abdeckt. Ich bin daher sehr froh, dass außer mir auch die Physikerin Anja Lindenau, Doktorandin am Humboldt Zentrum im GO-Bio-Projekt, sowie die Management-Expertin Elena von der Heyden im EXIST-Team, an Bord sind. Und nicht zuletzt gehört auch Professor Gather zum Gründungsteam.
Wurden Sie bei der Beantragung von EXIST-Forschungstransfer vom Gateway unterstützt?
Dr. Mischok: Sowohl das Gateway Exzellenz Start-up Center als auch die Transferabteilung der Uni Köln haben uns bei der Beantragung von GO Bio initial und von EXIST-Forschungstransfer sehr geholfen. Unsere Ansprechpartner haben die Anträge korrigiert, überarbeitet und uns bei der Ausarbeitung der Verwertungsstrategie geholfen, die wir für die Antragstellung brauchten. Das war schon sehr gut.
Und wie bereiten Sie sich ganz konkret auf Ihr Gründungsvorhaben vor?
Dr. Mischok: Wir haben an verschiedenen Trainingsformaten des Gateways teilgenommen – darunter auch Pitch-Trainings, bei denen wir unter anderem Probe-Pitches vor Publikum absolviert haben. Davon haben wir enorm profitiert, sei es beim Pitch vor der Jury von EXIST-Forschungstransfers oder inzwischen auch bei Präsentationen vor Investorinnen und Investoren. Außerdem wurden wir von den Mitarbeitenden des Gateway sowie von externen Coaches und Fachleuten aus dem Netzwerk zu ganz unterschiedlichen Themen beraten – etwa zu Schutzrechten, zur Geschäftsmodellentwicklung oder zu Marktanalysen. Über das Gateway haben wir zudem eine Business-Coachin kennengelernt, die uns seit der Antragstellung von EXIST-Forschungstransfer intensiv begleitet. Nach wie vor in engem Kontakt stehen wir auch mit der Transferabteilung der Uni Köln sowie mit PROvendis, einer Tochtergesellschaft von 28 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, die auf Technologietransfer spezialisiert ist und eine Reihe von Analysen etwa zu Patentfähigkeit und Marktpotenzial für uns durchgeführt hat. Insgesamt ist die Unterstützung, die wir auf diesem Weg erhalten haben, wirklich äußerst hilfreich – fachlich wie strategisch.
Als Nächstes stehen Veranstaltungen zum unternehmerischen Handwerkszeug auf dem Programm: Marketing, Finanzierung, rechtliche und steuerliche Grundlagen – also alles, was für eine erfolgversprechende Gründung wichtig ist.
Haben Sie auch am Gateway Inkubator teilgenommen?
Dr. Mischok: Dafür ist es aktuell noch etwas zu früh. Eine Teilnahme ist aber zu einem späteren Zeitpunkt durchaus denkbar. Da wir jedoch ein Deeptech-Vorhaben verfolgen, prüfen wir momentan, ob es möglicherweise eine speziellere, besser zugeschnittene Alternative für uns gibt.
Zwischen Wissenschaft und Wirtschaft liegen oft Welten. Wie empfinden Sie diesen Wechsel?
Dr. Mischok: Der ist tatsächlich gar nicht so einfach. In der Wissenschaft denkt man kaum über eine kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse oder über Geschäftsmodelle nach. Das spielt im Forschungsalltag schlicht keine Rolle. Ich musste zum Beispiel lernen, dass es wenig sinnvoll ist, mit einem vermeintlich perfekten Produkt oder einer fertigen Idee auf potenzielle Kunden zuzugehen. In der Praxis hat jeder Partner, jeder Kunde ganz eigene Anforderungen daran, wie der Filter funktionieren muss – je nach spezifischem Anwendungsfeld. Diese Rückkopplung in der Entwicklung mitzudenken, war für mich ein wichtiger Perspektivwechsel.
Sie sprechen von Partnern und Kunden. Sind das tatsächlich schon ernstzunehmende Kunden, die bereit sind, Ihre Technologie zu kaufen?
Dr. Mischok: Wir befinden uns noch im Entwicklungsprozess, haben also noch kein vermarktungsfähiges Filtersystem. Nichtsdestotrotz führen wir viele intensiven Gespräche zum Beispiel mit größeren Herstellern für Fluoreszenzmikroskope sowie mit Unternehmen, die im Bereich Light Detection and Ranging, also in Richtung Lasertechnologie, arbeiten. Wir sind außerdem an einem Forschungsprojekt an der Columbia University in New York beteiligt, wo unsere Filtertechnologie in der biologischen Forschung eingesetzt wird. Diese Kontakte sind zum Teil durch unser eigenes Netzwerk entstanden, zum Teil aber auch durch die Pressearbeit der Uni Köln im Zuge von EXIST-Forschungstransfer.
Wann planen Sie den Start Ihres Unternehmens?
Dr. Mischok: Wenn wir uns an der Timeline von EXIST-Forschungstransfer orientieren, wäre das im Sommer 2027. Bis dahin brauchen wir die Zeit, um ein marktfähiges Produkt zu entwickeln, die Skalierung voranzutreiben und unsere erste Finanzierungsrunde vorzubereiten.
Weitere Informationen:
Gateway – Exzellenz Start-up Center Universität zu Köln
Stand: 4. August 2025

„Die Initiative Exzellenz-Start-up-Center NRW fördert das Gateway - Exzellenz Start-up Center Universität zu Köln.“
- Start-up Talk
- Interview mit Dr. Andreas Mischok, Gründungsteam PoLightFilters
- Interview mit Lucas Jonas, Co-Founder der Einklang NE Solutions GmbH
- Interview mit Lennard Bennemann und Hendrik Wever, Gründungsteam PottPilz
- Interview mit Dr.-Ing. Surkamp und Jasper Helle, Gründungsteam PicoShape
- Interview mit Daniel Porzig, Co-Founder der heygrün GmbH
- Interview mit Dr.-Ing. Philip Schmitt, Gründungsteam mechIC
- Interview mit Dr. Maximilian Hartmann, Co-Founder der vGreens Holding GmbH
- Interview mit Antonia Langner, Co-Founderin der LastBIM GmbH
- Interview mit Leo Wiegand, Co-Founder der ONE WARE GmbH
- Interview mit Dr. Richard Ramakers, Co-Founder der O11 biomedical GmbH
- Interview mit Dr. Adam Widera und Dr. Michael Middelhoff, Gründungsteam CrisisCube
- Interview mit David Goldschmidt und Finn Rübo, Co-Founder der Datapods GmbH
- Interview mit Maximilian Spiekermann und Max Krause, Gründungsteam Simplyfined
- Interview mit Dana Aleff, Co-Founderin der Circonomit GmbH
- Interview mit Pia Hildebrandt, Co-Founderin der concepte Solutions GbR
- Interview mit Moritz Schmidt, Co-Founder der utilacy GmbH
- Interview mit Tobias Barg und Dr. Felix Sümpelmann, Co-Founder der aalto Health GmbH
- Interview mit Dr. Katharina C. Cramer, Gründungsteam Tiller Alpha
- Interview mit Felix Kathöfer, Co-Founder der KATMA CleanControl GmbH
- Interview mit Ronja Weidemann, Fabienne Ryll und Abirtha Suthakar, Gründungsteam PhosFad
- Interview mit Benjamin Kasten, Co-Founder der ladeplan UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Prof. Dr. Rafael Kramann, Prof. Dr. Rebekka Schneider, Co-Founder der Sequantrix GmbH
- Interview mit Yasin Demir, Co-Founder der GreenDeal GbR
- Interview mit Katharina von Stauffenberg, Co-Founderin von comuneo
- Interview mit Sven Maihöfer, Co-Founder der xemX materials space exploration GmbH
- Interview mit Dr. Johannes Wappenschmidt, Co-Founder der Vintus GmbH
- Interview mit Tobias Burger, Co-Founder der red cable robots GmbH
- Interview mit Philipp Pflüger, Co-Founder der ChemInnovation GmbH
- Interview mit Deniz Ates, Co-Founder der Who Moves UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Jakob Vanhoefer, Gründer der LightningPose GmbH
- Interview mit Dr. Reza Esmaillie, Co-Founder der Detechgene GmbH
- Interview mit Lukas Klaßen, Co-Founder von „Knowledge in a Box“
- Interview mit Dr. Philipp Wrycza, Co-Founder der Logistikbude GmbH
- Interview mit Christoph Milder, DEVITY-Team
- Interview mit Jonas Spieth, Co-Gründer der lodomo GmbH
- Interview mit dem Gründungsteam der Laminar Solutions UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Alexander Pöhler und Xiaojun Yang, Gründungsteam der assemblean GmbH
- Interview mit Marc Leonard Leineweber, Gründungsteam HoLa
- Interview mit Dr. Niklas Hellemann, Co-Founder der SoSafe
- Interview mit Hendrik Bissing, Gründungsteam SLVISIONS
- Interview mit Elena Kirchner, Co-Gründerin der umaversum reproductive health GmbH
- Interview mit Gerrit Agel, Co-Gründer der CYBRID GbR
- Interview mit Lena Benecken, Co-Gründerin der EASI Control GmbH
- Interview mit Sinem Atilgan, Co-Grünerin der 4traffic SET GmbH
- Interview mit Doris Korthaus, Co-Gründerin der Korthaus Pumpen GmbH
- Interview mit Dr.-Ing. Friederike Kogelheide, Gründungsteam Glim Skin
- Interview mit Moritz Schmidt, Teammitglied von Gemesys
- Interview mit Dr. Alexander Schneider und Michael Birkhoff, Co-Gründer der schnaq GmbH
- Interview mit dem Gründungsteam von Acuire
- Interview mit Dr.-Ing. Peter Schlanstein und Niklas Steuer, Co-Gründer der HBOX Therapies GmbH
- Interview mit Sven Wauschkuhn, Co-Gründer der Excellence Coatings GmbH
- Interview mit Anne Janser, Co-Gründerin von WorXplorer
- Interview mit Paul Sabarny und Lilian Schwich, Gründungsteam der cylib GmbH
- Interview mit Stefan Paulus, Co-Gründer der azernis GmbH
- Interview mit Steffen Gerlach, Co-Gründer der EEDEN UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Sandra Stoppert, Gründerin von „Grünes Konfetti“ und „Tanzraum Remscheid“
- Interview mit Dr. David Dung, Gründungsteam Midel Photonics
- Interview mit Dr. Michael Schmidt, Co-Gründer von ESKITEC
- Interview mit Magnus Schückes, Co-Gründer der Elona Health GmbH
- Interview mit Alexander Haufschild, Co-Gründer der socialbnb GmbH
- Interview mit Jan Bernholz, Co-Gründer der eseidon GmbH“
- Interview mit Dr. Robert Brüll, Co-Gründer der FibreCoat GmbH
- Interview mit Dr. Matthias Kiel, Geschäftsführer der qubeto GmbH
- Interview mit Marius Ruhrmannm, Geschäftsführer der MapAd GmbH
- Interview mit Sigrid Dispert, Gründungsteam Memogic
- Interview mit Nathalie Prokop, Co-Gründerin von noho
- Interview mit Michael Rieger, Co-Gründer der FreeD Printing GmbH
- Interview mit Dr. Timo Bathe und Alexander Ott, die Gründer der [Tool]Prep UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Sarah Theresa Schulte, Co-Gründerin der AllCup GbR
- Interview mit Christoph Seidenstücker, Co-Gründer der Pixel Photonics UG
- Jochen Schwill, Next Kraftwerke GmbH
- Thomas Roth, Co-Gründer des Medizintechnik-Start-ups InnoSurge AC
- Start-up Profiles